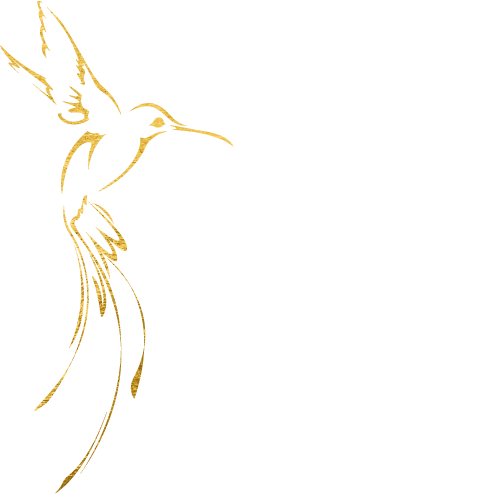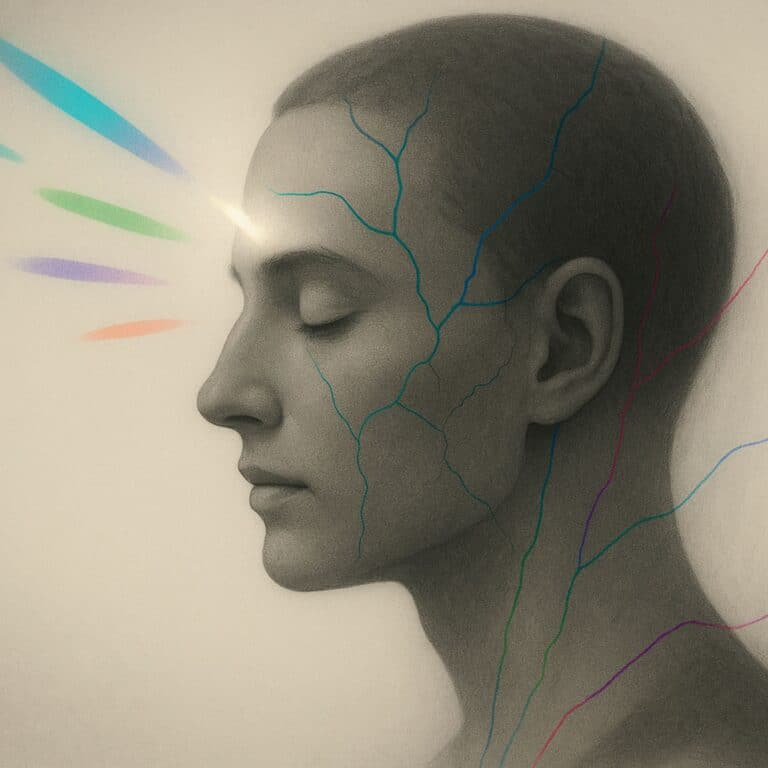Wenn das „Immer-weiter“ zur Erschöpfung führt
Manchmal geschieht es schleichend. Ein Projekt folgt dem nächsten, Termine drängen sich, die To-do-Liste wächst – und irgendwo dazwischen verschwindet das Gefühl von Leichtigkeit.
Wer viel Verantwortung trägt, sich stark einbringt oder für andere da ist, merkt oft erst spät, dass die eigene Energie langsam versiegt.
Burnout entsteht selten „einfach so“. Häufig sind es bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die Menschen besonders anfällig machen – Eigenschaften, die im Grunde wertvoll sind: Leistungsbereitschaft, Empathie, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein.
Doch wenn diese Stärken zu ständigen Antreibern werden, kippt das Gleichgewicht. Gerade im Zusammenhang von Burnout und Persönlichkeitsmerkmalen zeigt sich, wie aus Ressourcen allmählich Risikofaktoren werden. Dann wird aus Motivation Pflicht, aus Fürsorge Überforderung – und aus innerem Antrieb ein innerer Druck.
Vielleicht kennst du das Gefühl, dass „einfach mal abschalten“ gar nicht so leicht ist. Dass Gedanken kreisen, selbst wenn der Körper längst müde ist. Dass du eigentlich weißt, du solltest dir Ruhe gönnen – und es trotzdem nicht tust.
Diese leisen Momente sind oft die ersten Signale, dass etwas in uns zu stark geworden ist: ein Antreiber, der früher hilfreich war, jetzt aber zu viel Raum einnimmt.
Im Folgenden schauen wir uns an, wie Burnout und Persönlichkeitsmerkmale zusammenhängen, welche inneren Muster dabei eine Rolle spielen – und wie es gelingen kann, aus diesem Kreislauf auszusteigen.
Burnout und Persönlichkeitsmerkmale – was steckt wirklich dahinter?
Wenn wir über Burnout und Persönlichkeitsmerkmale sprechen, geht es nicht um Schuld oder „falsches Verhalten“.
Es geht darum zu verstehen, warum manche Menschen unter denselben äußeren Bedingungen deutlich schneller an ihre Grenzen kommen – und andere erstaunlich lange funktionieren, bis plötzlich nichts mehr geht.
Burnout entsteht auf der Schnittstelle von drei Ebenen:
- äußere Belastungen
- biologische Stressreaktion
- innere Muster und Persönlichkeitsmerkmale
Gerade der dritte Bereich wird in der Öffentlichkeit oft unterschätzt.
Dabei zeigt die klinisch-psychologische Forschung seit Jahren: Bestimmte Persönlichkeitsmerkmale erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Stress nicht mehr reguliert werden kann – selbst wenn die äußere Belastung scheinbar „normal“ ist (Gothaer).
Unsere Persönlichkeit bestimmt, wie wir
- Anforderungen wahrnehmen,
- Emotionen regulieren,
- mit Druck umgehen,
- Grenzen setzen
- und wie sehr wir uns über Leistung, Anerkennung oder Harmonie definieren.
Menschen, die später in einen Burnout geraten, haben häufig Eigenschaften, die eigentlich Stärken sind:
hohe Kompetenz, Verantwortungsgefühl, Verbindlichkeit, Empathie, Loyalität, Motivation.
Doch genau diese Stärken können sich unter Dauerstress gegen uns wenden. Wer beispielsweise sehr zuverlässig ist, spürt stärker das Bedürfnis, Erwartungen zu erfüllen.
Wer sehr empathisch ist, spürt die Belastungen anderer intensiver.
Wer sehr leistungsorientiert ist, beruhigt sich oft erst dann, wenn alles „perfekt“ erledigt ist.
So wird aus einem förderlichen Muster ein innerer Antreiber, der nicht mehr flexibel ist, sondern starr und übermächtig.
Wenn wir das Zusammenspiel von Burnout und Persönlichkeitsmerkmalen betrachten, tauchen immer wieder dieselben Mechanismen auf, durch deren psychologische Dynamik Burnout begünstigt wird:
1. Innere Verpflichtungen statt echter Wahlfreiheit
„Ich muss das schaffen.“
„Ich darf niemanden enttäuschen.“
„Ich muss stark sein.“
Diese Sätze wirken wie psychologische Automatismen. Der präfrontale Cortex (der u.a. für Abwägung zuständig ist) hat dann weniger Einfluss – alte Muster übernehmen die Kontrolle.
2. Stress wird nach innen abgefedert – nicht reguliert
Viele Menschen, die Burnout entwickeln, schlucken Stress herunter, funktionieren weiter, kompensieren im Stillen.
Doch was nach außen ruhig wirkt, ist innerlich oft:
- Grübeln
- Selbstkritik
- latente Anspannung
- erhöhte Wachsamkeit
- „Ich halte das schon aus“-Mentalität
Diese Art der Stressverarbeitung ist einer der stärksten Prädiktoren für Burnout – gerade dort, wo sich Burnout und Persönlichkeitsmerkmale gegenseitig verstärken.
3. Grenzen werden nicht gespürt, bevor sie überschritten werden
Burnout-Betroffene erkennen Überlastung selten früh.
Nicht, weil sie nicht achtsam wären – sondern weil ihr Nervensystem über Jahre gelernt hat:
„Ich gehe erst dann auf die Bremse, wenn es gar nicht mehr anders geht.“
Es entsteht ein Muster, das sich selbst verstärkt:
- äußere Anforderungen steigen
- innere Antreiber halten dagegen
- das Nervensystem bleibt dauerhaft aktiviert
- Erholung fühlt sich unruhig oder „falsch“ an
- es wird weitergemacht, bis nichts mehr geht
Zu beachten ist, dass Persönlichkeitsmerkmale keine Diagnose darstellen. Sie sind Orientierung.
Sie zeigen, wo jemand besonders verletzlich ist – und auch, wo seine größte Stärke liegt.
Denn die gleichen Merkmale, die Burnout und Persönlichkeitsmerkmale kritisch ineinandergreifen lassen, sind oft auch die Basis für:
- Mitgefühl
- Klarheit
- Mut
- Verantwortlichkeit
- beruflichen Erfolg
- zwischenmenschliche Tiefe
- Loyalität
- kreative Energie
Es geht also nicht darum, etwas „abzutrainieren“. Sondern darum, Flexibilität zurückzugewinnen – statt von inneren Antreibern geleitet zu werden, wieder in die eigene Steuerung zu kommen.
Wenn du dich grundsätzlich mit Stressmechanismen vertraut machen möchtest, kann dir dieser Beitrag helfen, deine eigenen Stressmuster besser zu erkennen: Stress erkennen und bewältigen
Im nächsten Abschnitt betrachten wir, welche Persönlichkeitsmerkmale in der Praxis besonders häufig vorkommen, wenn Menschen mit Burnout zu uns in die Praxis kommen – und warum gerade diese Muster so eng mit Erschöpfung und Überforderung verknüpft sind.
Typische Persönlichkeitsmerkmale bei Burnout
Wenn Menschen mit Erschöpfung oder innerer Überforderung in die Praxis kommen, zeigen sich oft wiederkehrende Persönlichkeitsmerkmale. Nicht als starre Kategorien, sondern als innere Haltungen, die sich über viele Jahre entwickelt haben.
Gerade in der Verbindung von Burnout und Persönlichkeitsmerkmalen lässt sich beobachten, wie wertvolle Stärken unter dauerhafter Belastung zu Druckfaktoren werden.
Der Perfektionist – getrieben von dem Wunsch, alles richtig zu machen
Perfektionistisch geprägte Menschen setzen auf Qualität, Klarheit und Verlässlichkeit. Sie möchten, dass Dinge wirklich gut werden. Dieser Anspruch ist oft die Grundlage für beruflichen Erfolg und große Loyalität.
Belastend wird es dann, wenn der innere Anspruch kaum noch Spielraum lässt. Jeder Schritt wird kontrolliert, jede Entscheidung mehrfach geprüft. Die Angst, etwas übersehen zu haben, erzeugt Anspannung, und das Gefühl, noch nicht „fertig“ zu sein, weicht kaum von der Seite.
Mit der Zeit entsteht ein Zustand, in dem kaum noch echte Entspannung möglich ist. Genau hier überschneiden sich Burnout und Persönlichkeitsmerkmale besonders deutlich: Der innere Druck ersetzt die innere Motivation.
Der Helfer – groß im Geben, zurückhaltend im Nehmen
Helfende Menschen spüren intuitiv, was andere brauchen. Sie sind zugewandt, fürsorglich und verlässlich. Viele Teams und Familien funktionieren nur deshalb so gut, weil diese Menschen im Hintergrund Stabilität schenken.
Doch beim Helfen kann leicht ein Ungleichgewicht entstehen. Wer sich stark an den Bedürfnissen anderer orientiert, übersieht oft die eigenen Grenzen. Es fühlt sich ungewohnt oder egoistisch an, etwas abzulehnen oder auszuruhen, wenn noch jemand Unterstützung bräuchte.
Über Wochen und Monate sammelt sich dadurch eine leise, aber stetige Erschöpfung an. Das Zusammenspiel von Burnout und Persönlichkeitsmerkmalen wird hier sehr klar: Der Wunsch, für andere da zu sein, lässt keinen Raum für die eigene Erholung.
Der Kämpfer – beeindruckende Stärke, die irgendwann zu viel verlangt
Kämpferische Menschen können unglaublich viel leisten. Sie bleiben fokussiert, auch wenn es anspruchsvoll wird, und finden immer noch eine letzte Kraftreserve. Viele von ihnen haben sich früh angewöhnt, Herausforderungen allein zu bewältigen.
Der Körper hält diesem Lebensstil erstaunlich lange stand. Doch innerlich wächst eine Müdigkeit, die nicht einfach verschwindet. Wenn Durchhalten zum Dauerzustand wird, verliert das Nervensystem die Chance, herunterzufahren.
So entsteht eine innere Überforderung, die lange unbemerkt bleibt. Burnout und Persönlichkeitsmerkmale greifen hier ineinander, weil Stärke zum einzigen erlaubten Zustand wird – selbst dann, wenn es längst zu viel ist.
Der Kontrollierende – Halt finden in Ordnung und Struktur
Menschen mit einem hohen Bedürfnis nach Kontrolle schaffen Übersicht, Planbarkeit und Sicherheit. In vielen beruflichen Rollen ist diese Fähigkeit enorm wertvoll.
Belastend wird es, wenn das Bedürfnis nach Kontrolle aus Sorge entsteht, etwas könnte schiefgehen, wenn man nicht „aufpasst“. Dann entsteht ein innerlicher Alarm, der kaum zur Ruhe kommt.
Delegieren fällt schwer, und selbst kleine Unsicherheiten fühlen sich an, als müssten sie sofort beseitigt werden. Mit der Zeit wird das anstrengend – nicht nur kognitiv, sondern auch körperlich.
In dieser Dynamik wird sichtbar, wie Burnout und Persönlichkeitsmerkmale sich gegenseitig verstärken, besonders dann, wenn Sicherheit nur noch über Anspannung erreichbar scheint.
Der Anpassungsfähige – Harmonie als oberste Priorität
Menschen mit hoher Anpassungsfähigkeit spüren Stimmungen und Bedürfnisse anderer oft sehr fein. Sie können Konflikte entschärfen, vermitteln und für ein angenehmes Miteinander sorgen. Diese Fähigkeit ist wertvoll und wird häufig sehr geschätzt.
Schwierig wird es, wenn Harmonie wichtiger wird als die eigene Wahrheit. Wer Konflikte vermeiden will, äußert Bedürfnisse oft nicht klar und stimmt zu, obwohl etwas innerlich nicht stimmig ist.
Das erzeugt Frustration, Spannung und eine leise Form der Selbstüberforderung. Mit der Zeit führt dieses Zurückhalten zu einem Energieverlust, der kaum bewusst auffällt – bis der Körper irgendwann nicht mehr mitmacht.
In dieser stillen Form wird die Verbindung zwischen Burnout und Persönlichkeitsmerkmalen besonders spürbar. Die äußere Ruhe steht im starken Kontrast zur inneren Anspannung.
Was all diese Muster gemeinsam haben
Ob Perfektion, Fürsorglichkeit, Durchhaltevermögen, Strukturbedürfnis oder Anpassungsfähigkeit – all diese Eigenschaften sind in ihrem Kern wertvolle Stärken. Menschen, die sie in sich tragen, können viel bewegen, gestalten Beziehungen verlässlich und bringen oft ein hohes Maß an Engagement mit.
Schwierig wird es, wenn diese Stärken ihre Flexibilität verlieren. Dann verwandeln sie sich in innere Antreiber, die immer weiterlaufen, auch wenn Körper und Psyche längst nach Ruhe verlangen. Die Person bleibt auf höherem Tempo, als ihr eigentlich guttut, weil das vertraute Muster stärker wirkt als das eigene Erschöpfungsgefühl.
In diesem Zustand entsteht eine Überforderung, die nach außen häufig kaum sichtbar ist. Viele Betroffene wirken weiterhin leistungsfähig und stabil, obwohl sie innerlich längst an ihre Grenzen geraten. Genau deshalb entwickeln gerade Menschen mit solchen Persönlichkeitsmerkmalen so oft einen Burnout. Sie halten durch, bis nichts mehr geht.
Wenn du unsicher bist, ob du eher „nur müde“ bist oder ob sich bereits typische Burnout-Muster zeigen, kann dir dieser Beitrag helfen, feiner zu unterscheiden – gerade im Zusammenspiel von Burnout und Persönlichkeitsmerkmalen: Burnout oder Erschöpfung?
Wenn innere Antreiber zu laut werden
In vielen Verläufen zeigt sich ein Moment, an dem persönliche Stärken nicht mehr ausbalanciert sind. Perfektion, Hilfsbereitschaft, Stärke, Struktur oder Harmoniebedürfnis – sie funktionieren dann nicht mehr als Ressourcen, sondern übernehmen das Steuer.
Dieses Kippen ist kein bewusster Entschluss, sondern ein inneres Geschehen, das sich schleichend entwickelt.
Wenn innere Programme automatisch übernehmen
Innere Antreiber entstehen meist früh im Leben. Sie dienen als Orientierung.
„Streng dich an.“
„Halt durch.“
„Sei für andere da.“
„Mach es richtig.“
„Halte den Frieden.“
Solange genügend Energie da ist, sind diese Programme hilfreich. Unter Dauerstress werden sie jedoch automatisch aktiviert und laufen wie ein Autopilot weiter – selbst dann, wenn sie nicht mehr passend sind.
Die betroffene Person merkt kaum, dass sie funktioniert, statt zu fühlen.
Wenn das Nervensystem den Alarmmodus nicht mehr verlässt
Dauerstress verändert die Stressachsen im Körper. Was früher ein kurzzeitiger Anstieg von Anspannung war, wird allmählich zum Grundzustand. Das Nervensystem bleibt auf „Bereitschaft“, selbst in eigentlich ruhigen Momenten.
Das führt zu:
- innerer Unruhe
- schlechterer Schlafqualität
- einem Gefühl von Getrieben-Sein
- Grübeln und Selbstkritik
- Schwierigkeiten abzuschalten
- körperlicher Anspannung ohne klaren Auslöser
Die innere Mitte geht verloren, weil das System keinen echten Erholungsmodus mehr erreicht.
Wenn Wahrnehmung und Realität auseinanderdriften
Viele Menschen mit Burnout berichten, dass sie ihre Erschöpfung kaum noch spüren.
Sie merken erst, wie belastet sie waren, wenn der Körper einknickt.
Das liegt daran, dass die Aufmerksamkeit nach außen gerichtet ist – auf Erwartungen, Aufgaben, Rollen und Ansprüche.
Innere Signale wie Müdigkeit, Gereiztheit oder emotionale Erschöpfung werden immer seltener wahrgenommen. Das eigene Befinden rutscht unbemerkt in den Hintergrund.
Wenn Entscheidungen nicht mehr frei sind
In diesem Zustand entsteht ein psychischer Mechanismus, der sich anfühlt wie ein Zwang zur Funktion.
Nicht im Sinne eines pathologischen Zwanges, sondern als Verlust von Wahlfreiheit.
Menschen berichten dann Sätze wie:
„Ich kann nicht anders.“
„Ich schaffe das schon, irgendwie.“
„Ich muss das noch durchziehen.“
„Ich habe gar keine andere Möglichkeit.“
Die inneren Antreiber diktieren das Tempo.
Der Mensch spürt keinen Raum mehr, um bewusst gegenzusteuern.
Wenn die Erschöpfung zur Identität wird
Viele Betroffene erleben nicht nur Müdigkeit, sondern eine Art inneren Zusammenbruch des Selbst.
Gedanken wie „Ich kann nicht mehr“ oder „Ich funktioniere nicht richtig“ tauchen häufiger auf.
Das liegt nicht an mangelnder Stärke – sondern daran, dass die psychischen Systeme nicht mehr flexibel reagieren können.
Burnout entsteht genau in diesem Zusammenspiel: Der Körper ist erschöpft, die Psyche überfordert, und die Persönlichkeit zu unflexibel geworden, um aus dem Muster auszusteigen.
Genau hier liegt der Kern von Burnout und Persönlichkeitsmerkmalen: Nicht die Persönlichkeit „ist falsch“, sondern ihre bisherigen Strategien reichen unter Dauerstress nicht mehr aus.
Warum dieser innere Mechanismus so entscheidend ist
Das Verstehen dieser Dynamik ist ein wichtiger Schritt. Nicht, weil man dadurch „alles lösen“ müsste, sondern weil klarer wird, was im Inneren eigentlich passiert.
Burnout entsteht selten durch einzelne Ereignisse. Viel häufiger entwickelt er sich aus einer anhaltenden Überforderung, bei der die inneren Antreiber stetig stärker werden, während die eigene Wahrnehmung leiser wird.
Wenn man begreift, wie sehr diese Muster den Alltag beeinflussen, wird auch spürbar, an welchen Punkten Veränderung möglich wird.
Dort, wo Burnout und Persönlichkeitsmerkmale früher unbemerkt die Führung übernommen haben, kann allmählich wieder Raum entstehen – für Selbstkontakt, für Erholung, für neue Entscheidungen, die nicht aus Druck, sondern aus Klarheit getroffen werden.
Im nächsten Schritt geht es darum, wie dieser Raum konkret entstehen kann und welche Wege unterstützen, aus dem übermäßigen Funktionieren zurück in eine innere Balance zu finden.
Wege aus dem Kreislauf
Wenn innere Antreiber über lange Zeit das Tempo bestimmen, fühlt es sich irgendwann so an, als gäbe es keinen Ausweg mehr. Viele Menschen beschreiben dieses Erleben wie einen inneren Knoten: Man weiß, dass es zu viel ist, spürt aber gleichzeitig kaum Zugang zu den eigenen Ressourcen.
Gerade deshalb ist es so wichtig zu verstehen, dass der Ausstieg aus diesem Kreislauf nicht über ein großes „Alles anders machen“ laufen muss. Veränderung entsteht Schritt für Schritt – meist leise, manchmal zaghaft, aber immer spürbar, wenn man wieder bei sich ankommt.
Wieder lernen, sich selbst wahrzunehmen
Der erste Weg führt oft über die Rückkehr zu den eigenen Empfindungen. Menschen, die aufgrund ihrer Persönlichkeitsmerkmale eher leistungsorientiert, fürsorglich oder kontrollierend sind, verlieren unter Stress schnell den Kontakt zu inneren Signalen.
Müdigkeit, Spannung oder innere Unruhe werden überdeckt, weil das Funktionieren im Vordergrund steht.
Es hilft, diese Wahrnehmung bewusst neu zu trainieren. Kleine Pausen, achtsame Momente, Atemübungen oder kurze innere Check-ins öffnen spätere Veränderungen überhaupt erst. Nicht als Pflicht, sondern als Möglichkeit, den eigenen Zustand wieder zu spüren.
Dieser Kontakt zu sich selbst ist oft der erste Boden, auf dem echte Erholung wieder stattfinden kann.
Mitgefühl statt Kritik
Viele Menschen, die mit Burnout ringen, sind sehr streng mit sich. Selbstverbote wie „Reiß dich zusammen“ oder „Du darfst jetzt nicht schwach sein“ klingen vertraut und hartnäckig.
Ein hilfreicher Schritt besteht darin, diese innere Stimme zu verändern.
Selbstmitgefühl bedeutet nicht, sich nur zu schonen oder weniger zu leisten. Es bedeutet, sich nicht zusätzlich unter Druck zu setzen, während man ohnehin schon erschöpft ist.
Mitfühlende Selbstzuwendung senkt nachweislich das Stressniveau, stabilisiert das Nervensystem und fördert die innere Flexibilität – ein Gegenpol zu den starren Mustern der Antreiber.
Neue Grenzen entwickeln
Grenzen sind kein Zeichen von Egoismus. Sie sind eine Form innerer Hygiene.
Besonders Menschen mit ausgeprägtem Perfektionismus, hoher Verantwortlichkeit oder starkem Harmoniebedürfnis haben gelernt, Grenzen eher still zu übergehen. Doch Burnout entsteht genau dort, wo die eigene Grenze dauerhaft ignoriert wird.
Es kann helfen, Grenzen zunächst im Kleinen zu üben.
Ein kurzer Moment des Innehaltens, bevor man zusagt.
Ein ehrliches Wahrnehmen, ob man etwas wirklich leisten kann.
Oder ein stilles inneres „Nein“, das erst später ausgesprochen wird.
Diese Schritte sind anfangs ungewohnt, aber sie schaffen einen neuen Spielraum – einen Raum, der nicht von Pflicht, sondern von innerer Klarheit getragen wird.
Erlaubnis zur Erholung
Erholung ist nicht passiv. Sie ist ein aktiver Prozess, der dem Körper ermöglicht, vom Dauerstress herunterzufahren.
Menschen mit starken inneren Antreibern empfinden Erholung jedoch häufig als „Zeitverlust“ oder haben das Gefühl, sie hätten sie nicht verdient.
Doch das Nervensystem kann sich nur regenerieren, wenn echte Pausen entstehen – Pausen, die nicht mit schlechtem Gewissen oder innerer Unruhe gefüllt sind.
Es kann entlastend sein, Erholung bewusst einzuplanen, damit sie nicht erst dann stattfindet, wenn gar nichts mehr geht. Kurze Auszeiten, Bewegung, Natur, tiefe Atmung oder Stille können den Körper stückweise aus dem Alarmmodus lösen.
Therapeutische Begleitung
Viele Menschen bemerken erst spät, wie stark ihre Persönlichkeitsmerkmale mit ihrem Burnout verknüpft sind.
Eine therapeutische Begleitung bietet die Möglichkeit, diese Muster in einem sicheren Raum sichtbar zu machen.
Dort entsteht Verständnis dafür, wie die inneren Antreiber funktionieren, wofür sie ursprünglich gedacht waren und wie sie sich verändern lassen, ohne die positiven Seiten dieser Persönlichkeitsmerkmale zu verlieren.
Therapie unterstützt dabei,
- innere Erschöpfung zu erkennen
- alte Muster zu verstehen
- Selbstwert zu stabilisieren
- Grenzen neu zu entwickeln
- sich wieder mit der eigenen Mitte zu verbinden
Der Weg führt nicht über Druck, sondern über Bewusstheit und kleine, konsequente Schritte.
Vielleicht spürst du, dass du dir Hilfe wünschst, bist dir aber unsicher, ob und wie du Psychotherapie in Anspruch nehmen möchtest – gerade, wenn es um Burnout und Persönlichkeitsmerkmale geht, die nicht immer klar in ein Kassensystem passen. Hier findest du einen Überblick, warum es sinnvoll sein kann, Psychotherapie auch selbst zu finanzieren und welche Vorteile das haben kann: Psychotherapie selbst zahlen – 8 gute Gründe
Ein neuer Blick auf die eigene Persönlichkeit
Wenn Menschen beginnen, ihre inneren Programme besser zu verstehen, verändert sich ihr Umgang mit sich selbst. Sie erkennen, dass Burnout nicht bedeutet, „falsch“ zu sein oder zu scheitern, sondern dass hoch ausgeprägte Stärken über viele Jahre zu viel Verantwortung getragen haben.
Mit der Zeit wird deutlich, dass Stärke und Sensibilität, Fürsorge und Klarheit, Struktur und Bedürftigkeit nebeneinander existieren dürfen.
Damit entsteht eine neue Form der inneren Balance – eine, in der man nicht mehr von Antreibern geleitet wird, sondern wieder selbst die Richtung bestimmen kann.
Ausblick: Burnout verstehen heißt, sich selbst verstehen
Wenn Menschen beginnen zu begreifen, wie eng Burnout und Persönlichkeitsmerkmale miteinander verwoben sind, entsteht oft eine fühlbare Erleichterung.
Plötzlich zeigt sich, dass die Erschöpfung nicht Ausdruck von Schwäche ist, sondern das Ergebnis einer langen inneren Überforderung, die oft aus den stärksten Anteilen der Persönlichkeit erwachsen ist.
Wer diesen Zusammenhang erkennt, öffnet sich für eine neue Perspektive auf sich selbst. Die (hinter den Antreibern steckenden) Stärken sollen nicht verschwinden, damit Erholung möglich wird. Sie dürfen und sollen bleiben – nur mit mehr Flexibilität, mit mehr Raum zum Atmen und mit einer inneren Haltung, die nicht von Druck, sondern von Achtsamkeit getragen wird.
Viele Menschen erleben in diesem Prozess etwas Befreiendes. Sie entdecken, dass sie mehr sind als ihr Funktionieren. Sie spüren wieder, dass ihre Persönlichkeit nicht das Problem ist, sondern ein Teil ihrer Geschichte – ein Teil, der sich entwickeln, heilen und wachsen darf.
Burnout zu verstehen bedeutet nicht nur, die Erschöpfung zu begreifen. Es bedeutet auch, die eigene Tiefe wiederzuentdecken und zu lernen, wie man sich selbst näherkommt, statt sich ständig zu überholen.
Dieses Verstehen ist kein Endpunkt, sondern ein Anfang. Ein Weg zurück zur inneren Balance, der leise beginnt und sich mit der Zeit stabilisiert – Schritt für Schritt.
Dein Weg zu mehr innerer Balance
In unserer Praxis CREA la VIE begleiten wir Menschen, die herausfinden möchten, wie sie ihre inneren Antreiber beruhigen und ihre persönliche Balance zurückgewinnen können.
Viele suchen Klarheit darüber, wie ihre eigenen Persönlichkeitsmerkmale sie sowohl stärken als auch erschöpfen können – und wie sich daraus ein Umgang entwickeln lässt, der nicht mehr von Überforderung geprägt ist.
Wenn du spürst, dass dich dieses Thema betrifft oder du dich in einzelnen Beschreibungen wiederfindest, kann ein gemeinsames Gespräch helfen, die nächsten Schritte deutlicher zu sehen.
Manchmal geht es um das Verständnis der eigenen Muster, manchmal um den Wunsch nach Stabilität, manchmal einfach um einen sicheren Raum, um wieder bei sich anzukommen.
Über unsere Website kannst du ein Erstgespräch buchen und dort auch bereits kurz angeben, welches Thema dich beschäftigt.
In diesem ersten Kennenlernen schauen wir gemeinsam, welche Unterstützung zu deiner Situation passt – behutsam, klar und in deinem Tempo.
Burnout entsteht oft leise. Der Weg hinaus beginnt oft genauso leise – mit dem ersten Moment, in dem man sich selbst wieder zuhört.
Ich hoffe, dass du aus diesem Beitrag etwas für dich mitnehmen konntest.
Vielleicht einen Gedanken, der nachklingt, oder einen kleinen Impuls, der dir gut tut.
Erlaub dir Pausen, wenn du sie brauchst – Schritt für Schritt zurück zu mehr Balance.
Herzlichst,
Deine Selda

Weiterführende Informationen zu Burnout
- Das Bundesportal gesund.bund.de bietet einen Überblick über Ursachen, Symptome und Behandlungsmöglichkeiten beim Burn-out-Syndrom.
- Das Frauengesundheitsportal informiert speziell zur seelischen Gesundheit von Frauen und zu Burn-out-Risiken.
- Die DGPPN (Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde) hat ein Positionspapier zu Burnout veröffentlicht, das Burnout als Risikozustand einordnet und auf die Abgrenzung zu anderen Erkrankungen eingeht.
- Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe stellt u.a. einen anonymen Selbsttest zur Verfügung, wenn du Anzeichen einer Depression bei dir prüfen möchtest – auch weil sich hinter einem vermeintlichen „Burnout“ manchmal eine behandlungsbedürftige Depression verbergen kann.